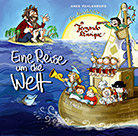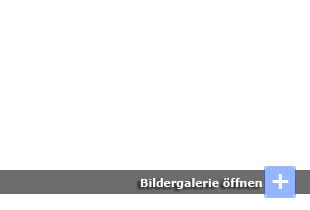Fischlexikon: Großer Hammerhai (Sphyrna mokarran)
JAVASCRIPT ist deaktiviert!
Ativiere Javascript oder wechsle zu unserer Seite
Salzwasserfische"
| Name: | Großer Hammerhai | |
| Ordnung: | Carcharhiniformes | |
| (deutsch) | Grundhaie | |
| Familie: | Sphyrnidae | |
| (deutsch) | Hammerhaie | |
| Gattung: | Sphyrna | |
| Gattung+Art: | Sphyrna mokarran | |
| Gesamt: | 3164 Fischarten | |
Übersicht
Der Große Hammerhai (Sphyrna mokarran) ist ein Meeresfisch aus der Familie der Hammerhaie und der Ordnung der Grundhaie.
Der Große Hammerhai kann eine Länge von über 600 cm erreichen und ist damit die größte Art der Familie Hammerhaie. Sein englischer Name lautet „Great hammerhead”.
Dieser Hai kommt weltweit in tropischen und warmen gemäßigten Gewässern vor. Er bewohnt Küstengebiete und den Kontinentalschelf, wobei er Korallenriffe bevorzugt.
Angriffe auf Menschen
Obwohl der Große Hammerhai potenziell gefährlich ist, greift er Menschen nur selten an. Manchmal verhält er sich Tauchern, Schwimmern und Surfern gegenüber neugierig. Manchmal stürmt er auf sie zu, wenn sie plötzliche Bewegungen machen. Es gibt jedoch auch Berichte, dass sich Große Hammerhaie Tauchern annähern oder diese beim Einsteigen ins Wasser attackieren.
Aufgrund seiner Größe und seiner scharfen Zähne ist er in der Lage, auch Menschen schwer zu verletzen. Er gilt als die aggressivste und gefährlichste Art der Hammerhaie. Dennoch basiert das aggressive Verhalten dieses Hais in den meisten Fällen auf Verteidigung und der Abwehr von Konkurrenz.
Bis zum Jahr 2012 wurden 37 Angriffe von Hammerhaien der Gattung Sphyrna auf Menschen gemeldet , davon waren 17 unprovoziert, jedoch keiner tödlich. Da sich Hammerhaie nur schwer voneinander unterscheiden lassen, ist unklar, wie viele dieser Angriffe durch Große Hammerhaie erfolgten.
Bedrohung und Schutz des Großen Hammerhais
Der Große Hammerhai wird in den Tropen regelmäßig sowohl kommerziell als auch zu Freizeitzwecken mit Langleinen, festen Grundnetzen, Haken und Leinen sowie Schleppnetzen gefangen.
Obwohl sein Fleisch selten verzehrt wird, werden seine Flossen aufgrund der hohen Nachfrage nach Haifischflossensuppe in Asien immer wertvoller. Darüber hinaus wird seine Haut für Leder, sein Leberöl für Vitamine und sein Kadaver für Fischmehl verwendet.
Der Große Hammerhai wird auch unbeabsichtigt als Beifang gefangen. Dabei liegt die Sterblichkeitsrate bei über 90 %, insbesondere im Nordwestatlantik und im Golf von Mexiko. Eine weitere Ursache für die hohe Sterblichkeit ist das Verfangen in Haifischnetzen vor den Stränden Australiens und Südafrikas.
In Queensland, Australien, ist es Freizeitfischern verboten, Hammerhaiarten zu fangen. In anderen nördlichen Bundesstaaten Australiens (Northern Territory und Western Australia) ist das gezielte Befischen und Fangen von Großen Hammerhaien jedoch erlaubt.
Da es weltweit nur eine relativ geringe Anzahl von Großen Hammerhaien gibt und ihre Entwicklungsdauer sehr lang ist, sind sie durch Überfischung stark gefährdet. Dieser Hai wird auf der IUCN Red List global als „vom Aussterben bedroht“ geführt.
Merkmale
die wichtigsten Merkmale des Großen Hammerhais:
- sein Körper ist stromlinienförmig gestreckt und sehr kräftig
- die Haut des Großen Hammerhais ist mit eng stehenden Hautzähnchen bedeckt
- jedes dieser Zähnchen ist rautenförmig und verfügt über drei bis fünf horizontale Rippen
- die Breite des großen, hammerförmigen Kopfes (Cephalofoil) beträgt 23–27 % der Körperlänge
- damit hat der Große Hammerhai, bis auf den Flügelkopf-Hammerhai (Eusphyrna blochii), den breitesten Kopf im Verhältnis zum Körper aller Arten der Gattung Sphyrna
- die Vorderkante des Kopfes ist fast gerade und ist sowohl in der Kopfmitte als auch beidseitig nahe dem Kopfrand deutlich eingebuchtet. Die Hinterkante ist leicht konkav
- erwachsene Große Hammerhaie können vom Bogenstirn-Hammerhai und vom Glatten Hammerhai anhand der Form des Cephalofoil unterschieden werden
- das breite Maul bildet von unten betrachtet eine parabolische Form
- in seinen Mundwinkeln sitzen kurze Labialfurchen (äußere Vertiefungen im Bereich der Mundwinkel)
- die Zähne sind dreieckig und stark gezähnt und werden zu den Mundwinkeln hin schräger. Auf beiden Seiten des Oberkiefers befinden sich siebzehn Zahnreihen mit zwei oder drei Zähnen an der Symphyse (der Mittellinie des Kiefers) und 16–17 Zähne auf beiden Seiten des Unterkiefers sowie ein bis drei Zähne an der Symphyse
- der Große Hammerhai besitzt 5 Kiemenspalten
- ein Spritzloch (Spiraculum) ist nicht vorhanden
- die Oberseite ist meist dunkelbraun bis hellgrau oder oliv gefärbt
- die Färbung wird ab der Körpermitte heller, die Bauchseite ist weißlich gefärbt
- ausgewachsene Exemplare besitzen an den Flossen keine besonderen Zeichnungsmerkmale, abgesehen von einem dunklen Rand an der Unterseite der Brustflossen. Bei jungen Exemplaren kann die Spitze der zweiten Rückenflosse schwarz gefärbt sein
- charakteristisch für den Großen Hammerhai ist die erste Rückenflosse. Sie ist sehr hoch, stark sichelförmig und beginnt über dem Ansatz der Brustflossen
- die zweite Rückenflosse und die Afterflosse sind beide relativ groß und haben tiefe Einkerbungen an den hinteren Rändern
- die sichelförmigen Bauchflossen haben im Gegensatz zu den gerade gerandeten Bauchflossen des Bogenstirn-Hammerhais konkave hintere Ränder
- die asymmetrisch geformte Schwanzflosse des Großen Hammerhais ist ebenfalls stark sichelförmig. Der untere Lobus ist schmal, der obere deutlich länger und besitzt einen kleinen Endlappen
Größe
Weibliche Große Hammerhaie (Sphyrna mokarran) können eine maximale Länge von über 600 cm (Weibchen) und ein Gewicht von über 500 Kilogramm erreichen. Männchen bleiben kleiner. Die durchschnittliche Länge dieser Haie beträgt etwa 350 cm, das durchschnittliche Gewicht etwa 230 kg.
Der längste jemals registrierte Große Hammerhai war 6,10 Meter lang. Außergewöhnlich große Exemplare können möglicherweise ein Gewicht von 900 Kilogramm erreichen, was jedoch noch nicht bestätigt wurde.
Im Jahr 2006 wurde vor der Küste von Boca Grande in Florida ein 440 cm langes und 580 Kilogramm schweres Weibchen gefangen. Das Weibchen war trächtig und stand kurz vor der Geburt von 55 Jungtieren.
Maximales Alter
Das Höchstalter des Großen Hammerhais (Sphyrna mokarran) beträgt etwa 30-40 Jahre.
Lebensweise, Lebensraum, Vorkommen
Der Große Hammerhai (Sphyrna mokarran) bewohnt tropische Gewässer auf der ganzen Welt zwischen dem 37. und 40. Breitengrad. Im Atlantik kommt er von North Carolina bis Uruguay vor, einschließlich des Golfs von Mexiko und der Karibik, sowie von Marokko bis Senegal und im Mittelmeer.
Am gesamten Rand des Indischen und Pazifischen Ozeans gibt es Vorkommen des Großen Hammerhais, von den Ryūkyū-Inseln bis Australien, Neukaledonien und Französisch-Polynesien sowie vom südlichen Baja California bis Peru.
Möglicherweise kommt er auch vor Gambia, Guinea, Mauretanien, Sierra Leone und der Westsahara sowie gelegentlich in der Nähe von Hawaii vor, dies wurde jedoch noch nicht bestätigt.
Große Hammerhaie leben in Küstengewässern mit einer Tiefe von weniger als einem Meter bis zu einer Tiefe von 80 Metern. Sie bevorzugen Korallenriffe, bewohnen aber auch Kontinentalschelfe, Inselterrassen, Lagunen und tiefe Gewässer in Küstennähe. Sie sind Wanderfische: Populationen vor Florida und im Südchinesischen Meer ziehen im Sommer nachweislich näher an die Pole heran.
Der Große Hammerhai ist ein nomadisch lebender Einzelgänger, der anderen Riffhaien in der Regel ausweicht. Begegnet er anderen Haien seiner Größe, zeigt er ein Drohverhalten, bei dem er seine Brustflossen hängen lässt und steif und ruckartig schwimmt.
Während Jungtiere von größeren Haien, wie etwa Bullenhaien (Carcharhinus leucas), erbeutet werden, haben größere und ausgewachsene Hammerhaie keine natürlichen Feinde, abgesehen vom Menschen. Gelegentlich begleiten Schwärme von Pilotfischen (Naucrates ductor) den Großen Hammerhai.
Fortpflanzung
Wie andere Hammerhaie ist auch der Große Hammerhai (Sphyrna mokarran) lebendgebärend (ovovivipar).
Sobald die sich entwickelnden Jungen ihren Dottervorrat aufgebraucht haben, verwandelt sich der Dottersack in eine Struktur, die einer Plazenta bei Säugetieren ähnelt.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Haien, die sich auf oder in der Nähe des Meeresbodens paaren, wurden Große Hammerhaie bei der Paarung in der Nähe der Oberfläche beobachtet.
Einem Bericht von den Bahamas zufolge stieg ein Paar auf, während es umeinander schwamm, und paarte sich, als es die Oberfläche erreichte.
Die Weibchen paaren sich alle zwei Jahre und bringen auf der Nordhalbkugel vom Spätfrühling bis in den Sommer und in australischen Gewässern von Dezember bis Januar ihre Jungen zur Welt.
Die Tragzeit beträgt elf Monate. Die Wurfgröße reicht von sechs bis 55 Jungen, typischerweise sind es 20 bis 40. Die Jungen sind bei der Geburt 50 bis 70 cm groß.
Männchen erreichen die Geschlechtsreife bei einer Länge von 2,3–2,8 m und einem Gewicht von 51 kg, Weibchen bei einer Länge von 2,5–3,0 m und einem Gewicht von 41 kg. Die Jungtiere unterscheiden sich von den Erwachsenen durch einen abgerundeten Vorderrand am Kopf.
Die typische Lebenserwartung dieser Art beträgt 20–30 Jahre, das Rekordweibchen aus Boca Grande wurde jedoch auf 40–50 Jahre geschätzt.
Nahrung
Der Große Hammerhai (Sphyrna mokarran) ist ein aktiver Räuber, der sich sehr abwechslungsreich ernährt.
Zu seinen bekannten Beutetieren zählen wirbellose Tiere wie Krabben, Hummer, Kalmare und Tintenfische sowie Knochenfische wie Tarpune, Sardinen, Welse, Froschfische, Meerbrassen, Stachelmakrelen, Umberfische, Zackenbarsche, Plattfische, Kofferfische und Igelfische. Auch kleinere Haie wie Glatthaie stehen auf seinem Speiseplan..
Im Rangiroa-Atoll jagen Große Hammerhaie opportunistisch Graue Riffhaie, die sich bei der Partnersuche erschöpft haben. Große Hammerhaie sind auch als Kannibalen bekannt.
Große Hammerhaie sind die Spitzenprädatoren unter den Haien und darauf spezialisiert, andere Haie, Rochen und weitere Arten zu fressen, insbesondere Stechrochen.
Die giftigen Stacheln der Stechrochen stecken häufig in ihrem Maul, ohne den Hai zu stören. Ein vor der Küste Floridas gefangener Hai hatte 96 Stacheln im und um das Maul.
Große Hammerhaie jagen hauptsächlich in der Morgen- oder Abenddämmerung.
Dabei schwingen sie ihre Köpfe in weiten Winkeln über den Meeresboden, um mit den zahlreichen Lorenzinischen Ampullen an der Unterseite ihres stark verbreiterten Kopfes, dem sogenannten Cephalofoil, die elektrischen Signale von im Sand vergrabenen Stechrochen aufzunehmen.
Das Cephalofoil dient auch als Tragfläche, mit der sich der Hai schnell umdrehen und nach einem entdeckten Rochen schlagen kann.
Vor Florida sind Große Hammerhaie oft die Ersten, die frisch ausgelegte Haiköder erreichen. Dies lässt auf einen besonders gut ausgebildeten Geruchssinn schließen.
Eine weitere Funktion des verbreiterten Kopfes lässt sich durch die Beobachtung ableiten, wie ein Großer Hammerhai einen Amerikanischen Stechrochen (Dasyatis americana) auf den Bahamas angriff.
Der Hai drückte den Rochen zunächst mit einem kräftigen Schlag von oben auf den Meeresboden und hielt ihn mit seinem Kopf fest, während er sich drehte. So konnte er auf beiden Seiten der Brustflossenscheibe des Rochens einen großen Bissen herausreißen.
Dadurch wurde der Stechrochen effektiv bewegungsunfähig gemacht und konnte anschließend mit dem Maul aufgenommen und durch schnelle Kopfbewegungen zersägt werden.
Ein Großer Hammerhai wurde auch dabei beobachtet, wie er einen Gefleckten Adlerrochen (Aetobatus narinari) im offenen Wasser angriff und ihm mit einem Biss ein großes Stück aus einer Brustflosse herausriss.
Nachdem der Rochen so außer Gefecht gesetzt war, drückte der Hai ihn erneut mit seinem Kopf auf den Boden und drehte sich, um den Rochen mit dem Kopf voran zwischen seine Kiefer zu nehmen.
Diese Beobachtungen legen nahe, dass der Große Hammerhai versucht, Rochen mit dem ersten Biss außer Gefecht zu setzen – eine Strategie, die auch der Weiße Hai (Carcharodon carcharias) anwendet. Zudem scheint der verbreiterte Kopf des Großen Hammerhais eine Anpassung an die Jagd auf Rochen zu sein.
Krankheiten
häufige Krankheiten bei Haien:
- Bakterielle Erkrankungen
Haie können sich mit Bakterien und Viren infizieren, die zu verschiedenen Krankheiten führen können [weiterlesen...] - Parasitäre Erkrankungen
Haie können sowohl von äußeren als auch von inneren Parasiten (z.B. Bandwürmer) befallen werden. Der Große Hammerhai wird von mehreren Ruderfußkrebsarten parasitiert, darunter Alebion carchariae, A. elegans, Nesippus orientalis, N. crypturus, Eudactylina pollex, Kroyeria gemursa und Nemesis atlantica
[weiterlesen...] - Krebs
Haie können auch an Krebs erkranken, aber das ist seltener als bei anderen Tieren. - Hirnerkrankungen
Meningoenzephalitis, eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, wurde als Todesursache bei Haien festgestellt.
Die Forschung zu Krankheiten bei Haien ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Es existieren wahrscheinlich noch weitere Krankheiten, die jedoch noch nicht endgültig erforscht wurden.
Literaturhinweis
- Wikipedia (deutsch)
- Wikipedia (englisch)
- Fishbase (englisch)
- IUCN Red List (englisch)
Urheberrechte für den Text
Bildrechte
Viele Bilder unseres Fischlexikons sind durch Creative Commons (abgekürzt CC) oder andere Urheberrechte geschützt. Creative Commons ist nicht der Name einer einzigen Lizenz. Die verschiedenen Lizenzen von Creative Commons weisen vielmehr große Unterschiede auf. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen findet Ihr [hier].
Informationen zur GNU-Lizenz für freie Dokumentation (kurz: GFDL) findet ihr [hier].
Die Urheber und Lizenzrechte für die Bilder auf dieser Seite werden angezeigt, wenn Ihr auf das jeweilige Bild oder auf "Bildrechte anzeigen" klickt.
Alle Bilder wurden von uns digital bearbeitet und in der Größe beschnitten.
Haftungsausschluss, Youtube-Videos
Alle Artikel unseres Fischlexikons dienen ausschließlich der allgemeinen Information und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.
Wenn diese Seite Videos enthält und Ihr ein Video anklickt (öffnet), werden personenbezogene Daten (IP-Adresse) an den Betreiber des Videoportals (YouTube) gesendet. Daher ist es möglich, dass der Videoanbieter Eure Zugriffe speichert und Euer Verhalten analysieren kann. Dies geschieht jedoch erst, wenn Ihr ein Video auf dieser Seite öffnet.
Alle Bilder wurden von uns digital bearbeitet und beschnitten. Weitere Infos unter "Bildrechte".